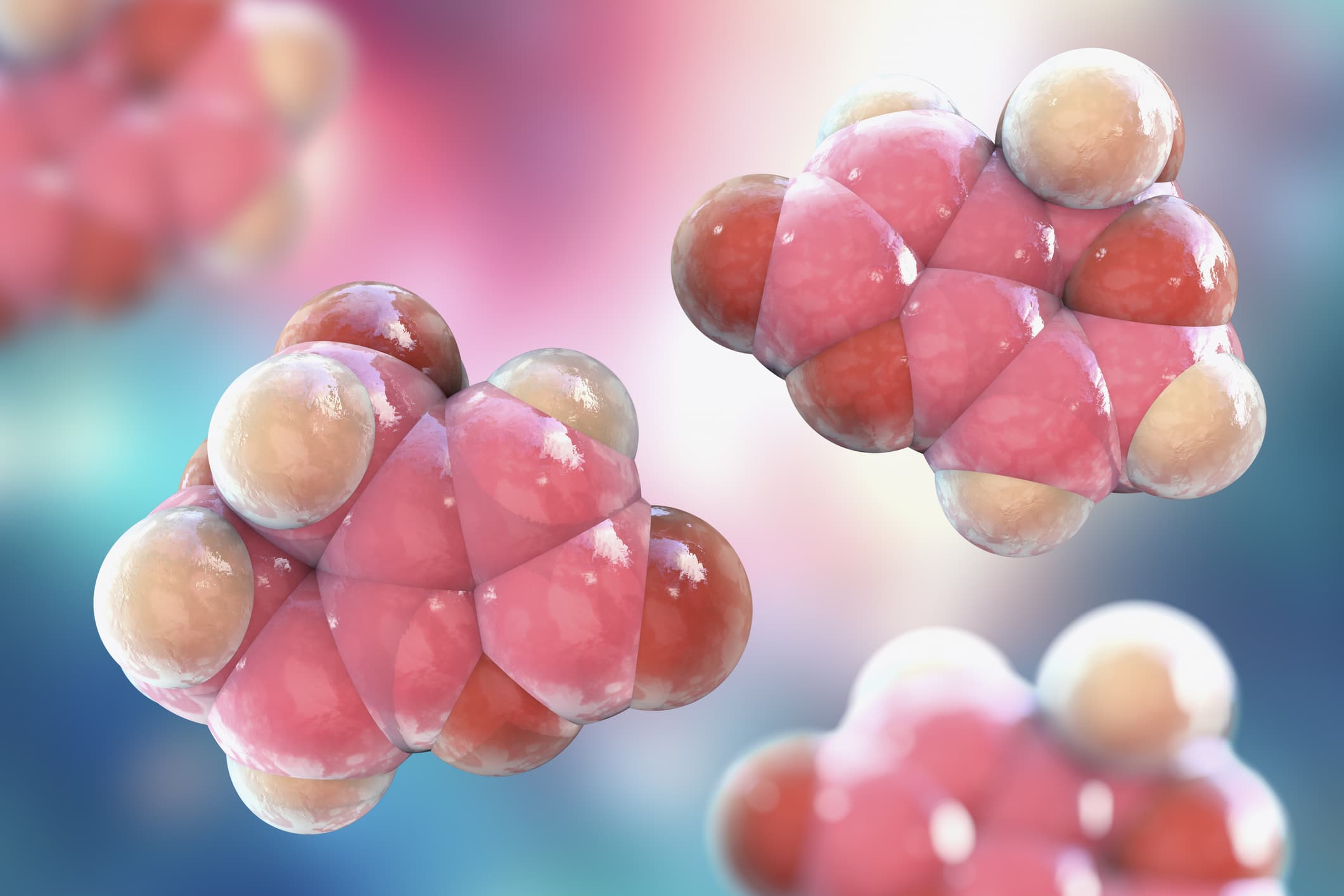ISO/DIS 10993-1:2024-07– Was regelt diese Norm?
Der erste Teil der Normenreihe ISO 10993 ist die grundlegende Vorschrift, die den erforderlichen Arbeitsablauf für die biologische Bewertung von Medizinprodukten ganzheitlich beschreibt, indem sie den biologischen Bewertungsprozess an den Grundsätzen des Risikomanagements für Medizinprodukte gemäß ISO 14971 ausrichtet.
Um die wichtigsten Punkte zu nennen: Der aktuelle Entwurf der Basisnorm ISO/DIS 10993-1 hilft dem Hersteller, das Medizinprodukt unter Berücksichtigung seiner Zweckbestimmung, vorhersehbarer Fehlanwendungen, der Kontaktdauer und der Art des Kontakts mit dem Körper von Patienten und Anwendern zu kategorisieren. Er zeigt Wege auf, wie vorhandene Daten aus verschiedenen Quellen bewertet, Lücken in den vorhandenen Daten identifiziert und diese Lücken geschlossen sowie zusätzliche Daten erhoben werden können, um verbleibende Risiken zu mindern und schließlich die biologische Bewertung abzuschließen.
Was sind die wichtigsten Änderungen gegenüber der aktuellen Version der ISO 10993-1?
ISO/DIS 10993-1:2024-07 bringt einige Änderungen gegenüber der derzeit harmonisierten Norm mit sich. Wir werden uns insbesondere auf die drastischen Änderungen konzentrieren, die erhebliche Auswirkungen auf die Kategorisierung der Produkte und den gesamten Bewertungsprozess haben werden.
- Kategorisierung des Gerätekontakts für kumulative Kontaktdauer „Konzept der Gesamtexpositionsdauer“: In diesem Zusammenhang ergab sich eine wesentliche Änderung bei der Zählung der kumulierten Kontaktdauer. Für die Bestimmung der Gesamtkontaktdauer sind nun die Tage, an denen das Gerät verwendet wird, entscheidend und nicht mehr die genauen Zeiträume der tatsächlichen Anwendung. Ein Beispiel:
Wenn ein Gerät innerhalb eines Zeitraums von einer Woche für eine Stunde pro Tag verwendet werden soll, bedeutet dies, dass von nun an eine Kontaktdauer von 7 Tagen anstelle von 7 x 1 Stunde (7 Stunden) berücksichtigt werden muss.
Mit anderen Worten: Jede Kontaktdauer von mehr als einer Minute pro Tag ist als 24-Stunden-Kontakt anzusehen. Diese Änderung kann sich somit erheblich auf die Einstufung von Geräten auswirken.
- Für Medizinprodukte, die „sehr kurz mit dem Körper in Kontakt kommen, in der Regel weniger als eine Minute“, kann der Hersteller eine schriftliche Begründung vorlegen, aus der hervorgeht, dass kein Potenzial für biologische Schäden besteht, sodass eine biologische Bewertung entfallen kann.
- Bioakkumulation wurde als ein Konzept eingeführt, das bei einer kumulativen Exposition gegenüber einem Medizinprodukt berücksichtigt werden muss. Bekanntlich haben einige Verbindungen (z. B. einige Vertreter der PFAS-Familie) das Potenzial zur Bioakkumulation. In solchen Fällen wird die Kontaktdauer unabhängig von der vorgesehenen Verwendungsdauer als langfristig festgelegt, sofern nicht anders begründet.
- Über die beabsichtigte Verwendung hinaus müssen vorhersehbare Fehlanwendungsszenarien für das Medizinprodukt in Bezug auf den Patienten berücksichtigt werden (weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im entsprechenden Abschnitt).
- Da Medizinprodukte zunehmend als Produkte für den Heimgebrauch/Point-of-Care-Produkte vertrieben werden, muss eine breitere Gruppe von Anwendern berücksichtigt werden, die mit Geräteteilen in Kontakt kommen könnten.
Die Gerätekategorie „von außen mit dem Körperinneren in Kontakt kommende Medizinprodukte” wurde im neuen Entwurf gestrichen. Produkte, die zuvor dieser Kategorie zugeordnet waren, werden nun entsprechend ihrer Art des Kontakts unterteilt in Produkte, die einerseits Kontakt zu erreichbaren oder beeinträchtigten
- Oberflächen oder inneren Geweben außer zirkulierendem Blut haben, und andererseits Produkte, die direkten oder indirekten Kontakt zu Blut haben.
- Die Anwendungsbereiche für die Endpunkte Genotoxizität und Karzinogenität wurden erweitert: Alle Medizinprodukte mit längerem Kontakt, die eine Bewertung der systemischen Toxizität erfordern, müssen nun auch auf Genotoxizität geprüft werden. Dieser Endpunkt muss auch für Produkte bewertet werden, die mit Schleimhäuten, verletzten oder geschädigten Hautflächen in Kontakt kommen, sowie für alle Arten von indirektem Blutkontakt (was zuvor nur für längeren Kontakt galt). Die Karzinogenität muss nun für Produkte mit langfristigem Schleimhautkontakt und für alle anderen Medizinprodukte mit langfristigem Kontakt, die einer Bewertung der chronischen Toxizität unterzogen werden müssen, bewertet werden.
- Der Tierschutz wird betont (Kapitel 4.3): Neben der Erwähnung von In-silico Verfahren, die neu sind, und der klaren Einschränkung von Tierversuchen als solche wird betont, dass, wenn Tierversuche unvermeidbar sind, das Versuchsdesign so gestaltet sein sollte, dass eine minimale Anzahl von Tieren erforderlich ist und ein maximaler Gewinn an extrahierbaren Informationen aus dieser Art von Tests erzielt wird. Für alle durchgeführten Tierversuche ist eine Begründung erforderlich.
- Die Vorlage von Referenzen für die an der biologischen Bewertung beteiligten Spezialisten ist nun obligatorisch. Der Lebenslauf sollte ausreichende Fachkenntnisse („angemessene Qualifikation“) für die Durchführung dieser Art von Bewertung nachweisen.
- Die umfangreiche Endpunkt-Tabelle wurde nun entsprechend den Gewebekontakttypen in einzelne Tabellen aufgeteilt.
- Physikalische und/oder chemische Informationen wurden aus den zu berücksichtigenden biologischen Auswirkungen entfernt, jedoch wird die chemische Charakterisierung im Allgemeinen stärker betont.
- Früher wurden „Pyrogenität“ und „Reproduktions- und Entwicklungstoxizität“ als biologische Auswirkungen in den Endpunkt-Tabellen aufgeführt. Diese biologischen Auswirkungen wurden in das neue Kapitel „Sonstige biologische Auswirkungen“ verschoben. Grundsätzlich wurde der Umfang dieser biologischen Auswirkungen in dieser Norm eingeschränkt und besser definiert. Insbesondere sollten sie bewertet werden, wenn das Medizinprodukt neuartige Materialien enthält. Die Reproduktions- und Entwicklungstoxizität sollte auch dann besonders bewertet werden, wenn empfindliche Patientengruppen (z. B. Schwangere) berücksichtigt werden müssen und wenn das Medizinprodukt und seine Bestandteile lokal in den Fortpflanzungsorganen vorhanden sein könnten. Weitere Sonderfälle, in denen diese biologische Auswirkung bewertet werden sollte, sind in Kapitel 6.5.11 aufgeführt (z. B. topische Anwendungen von Medizinprodukten, bei denen eine erhebliche Absorption durch die Haut oder Schleimhäute beabsichtigt ist, usw.). Die chemische Analyse von herauslösbaren und extrahierbaren Bestandteilen liefert nützliche Erkenntnisse, wenn diesen beiden biologischen Auswirkungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden muss.
- Das Konzept der Neurotoxizität wird eingeführt, das in der aktuellen Norm ISO 10993-1 fehlt. Die Neurotoxizität sollte für Produkte bewertet werden, die in direkten Kontakt mit Geweben des zentralen oder peripheren Nervensystems oder in indirekten Kontakt mit Nervengewebe oder Zerebrospinalflüssigkeit kommen.
- Die biologische Äquivalenz wird als eigenes Kapitel (Kapitel 6.7) eingefügt. In der neu gegliederten Norm wird die Verwendung von Daten für den Quervergleich mit bestehenden/vorherigen Produkten mit ähnlichen/vergleichbaren Eigenschaften hervorgehoben. Diese vergleichbaren Eigenschaften können eine
- chemische,
- physikalische,
- Kontakt- und
- Material
Äquivalenz sein. Dieses Konzept gilt insbesondere für Produkte mit einer etablierten, umfangreichen klinischen Anwendungsgeschichte in der relevanten Kontaktkategorie.
Es sei erneut darauf hingewiesen, dass die oben aufgeführte Liste nicht vollständig ist. Weitere Änderungen der Definitionen und Formulierungen innerhalb der neu strukturierten Norm müssen berücksichtigt werden. Aufgeführt sind jedoch sicherlich diejenigen Änderungen, die unserer Meinung nach die größten Herausforderungen für die biologische Beurteilung darstellen.
Generell lässt sich feststellen, dass die Verknüpfung/Harmonisierung zwischen der Basisnorm für die biologische Bewertung und der Norm für das Risikomanagement im neuen Entwurf ISO/DIS 10993-1:2024.07 stärker betont wird, wodurch sich der Umfang der Bewertung von einer vorgeschriebenen To-Do-Checkliste zu einem stärker risikobasierten Ansatz verschiebt. Maßnahmen zur Risikobeherrschung, die in der folgenden Reihenfolge angewendet werden und aus der ISO 14971 abgeleitet sind, werden hervorgehoben:
- sicheres Designund sichere Herstellung,
- zu implementierende Schutzmaßnahmen und
- Schulung und Information der Anwender.
Nachdem diese risikomindernden Maßnahmen durchgeführt wurden, muss das verbleibende Gesamt-Restrisiko neu bewertet werden.
Vorhersehbare Fehlanwendung – ein neues „Hindernis”, das bei Ihrer biologischen Bewertung berücksichtigt werden muss
Der neue Entwurf der ISO 10993-1 unterstreicht, dass Hersteller nicht nur verpflichtet sind, ihr Produkt entsprechend seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch zu bewerten.
Vorhersehbare Fehlanwendung, der bereits in anderen Normen (z. B. ISO 14971 – als vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung) oder Leitlinien (z. B. MDCG 2019-16 – EC) beschrieben ist, wurde nun auch in den neuen Entwurf aufgenommen.
- vernünftigerweise vorhersehbaree Fehlanwendung:
Verwendung eines Medizinprodukts (3.25) in einer Weise, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist (3.23), die sich jedoch aus leicht vorhersehbarem menschlichem Verhalten ergeben kann
Anmerkung 1 zum Eintrag: Leicht vorhersehbares menschliches Verhalten umfasst das Verhalten aller Arten von Anwendern (3.36), z. B. Laien und professionelle Anwender (3.36).
Anmerkung 2 zum Eintrag: Eine vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung kann vorsätzlich oder unbeabsichtigt sein.
Per Definition liegt eine vorhersehbare Fehlanwendung vor, wenn ein Medizinprodukt in einer Weise (miss)braucht wird, die als vernünftig angesehen werden kann, oder, mit anderen Worten, aus leicht vorhersehbarem menschlichem Verhalten resultiert, aber vom Hersteller nicht beabsichtigt ist. Vorhersehbare Fehlanwendung kann absichtlich oder unabsichtlich erfolgen.
Um ein Beispiel für diese Optionen zu nennen, betrachten wir ein Endoskop für die Urethroskopie. Obwohl es für den Einsatz im urologischen Bereich vorgesehen ist und seine Zweckbestimmung auch in der zugehörigen Gebrauchsanweisung für dieses Gerät so beschrieben ist, könnte ein mögliches vorhersehbares Fehlanwendungsszenario darin bestehen, dass eine medizinischer Fachkraft dieses Endoskop für gynäkologische Untersuchungen verwendet, um beispielsweise Kosten für ein eigentliches Urethroskop zu sparen. Die Eigenschaften des für urologische Anwendungen konzipierten Endoskops (Länge und Durchmesser des Endoskopschafts) ermöglichen höchstwahrscheinlich auch seine Verwendung für gynäkologische Anwendungen, da der Eintritt in die Gebärmutter durch breitere Körperhöhlen wie den Gebärmutterhals im Vergleich zum Eintritt durch die Harnröhre leichter zu realisieren ist. Mögliche vorhersehbare Fehlanwendungsszenarien könnten sich auch aus Bearbeitung am Gerätedesign ergeben, um dessen Anwendungsbereich zu erweitern.
Um beim Beispiel des Endoskops zu bleiben: Eine aggressive Verwendung eines Endoskops, die zu einem tieferen Eindringen in die vorgesehenen Körperhöhlen führt, als vom Hersteller vorgesehen, führt zu einem unbeabsichtigten vorhersehbaren Fehlanwendungsszenario.
Wie können sich diese vorhersehbaren Fehlanwendungsszenarien auf Ihre biologische Bewertung auswirken?
Zunächst einmal könnten Teile/Materialien des Produkts, die zuvor als Teile ohne Kontakt (zum Patienten und/oder Anwender) eingestuft wurden, in den Fokus rücken und ein Dilemma schaffen, wenn sie bei der biologischen Prüfung/chemischen Charakterisierung berücksichtigt werden müssen (mehr zu diesem Aspekt später).
Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist, dass die zuvor festgelegten biologischen Endpunkte, die zu bewerten waren, wenn ausschließlich die Zweckbestimmungim Rahmen lag, möglicherweise entsprechend den möglichen vorhersehbaren Fehlanwendungsszenarien überarbeitet werden müssen. Sogar die Kategorisierung des Medizinprodukts könnte sich durch Optionen vorhersehbarer Fehlanwendungen ändern, da verschiedene Arten von Haut und Körperflüssigkeiten mit dem Produkt in Kontakt kommen könnten.
Vorhersehbare Fehlanwendung kann auch zu einer anderen Nutzungsdauer des Produkts und zur Verwendung des Medizinprodukts bei anderen Patientengruppen als den vom Hersteller des Produkts vorgeschriebenen führen.
Zurück zu den biologischen Tests: Es könnte erhebliche Auswirkungen auf den zuvor berechneten Wert des Analytical Evaluation Threshold(AET) geben. Vorhersehbare Fehlanwendungen könnten dazu führen, dass Änderungen der Anzahl der täglich verwendeten Produkte oder der Häufigkeit der Verwendung eines Produkts über einen bestimmten Zeitraum und/oder der Kontaktdauer und der wiederholten Expositionszeiten in Betracht gezogen werden müssen. Insbesondere der C-Term der AET-Berechnung müsste möglicherweise geändert werden. Zudem gilt: Auch wenn die ISO 10993-12 festlegt, dass Medizinprodukte ohne Körperkontakt von biologischen Tests ausgenommen werden sollen, können – wie oben erwähnt – Teile ohne Kontakt jedoch zu Teilen mit Kontakt werden, wenn auch vorhersehbare Fehlanwendungsszenarien berücksichtigt werden.
In solchen Fällen könnte ein Kompromiss sinnvoll sein: Diese „vorhersehbaren Fehalwendungskontaktteile“ – die per Definition immer noch Teile ohne Kontakt sind – könnten zusammen mit den „vorgesehenen Kontaktteilen“ extrahiert werden. Die Flächen dieser „vorhersehbaren Fehlanwendungskontaktteile” könnten jedoch bei den Berechnungen zur toxikologischen Risikobewertung ignoriert werden. Dieses Konzept würde ein Worst-Case-Szenario unterstützen, indem es die Möglichkeit zusätzlicher Schadstofffreisetzungen in die Extrakte einbezieht, aber eine „Verdünnung” der Konzentrationen aufgrund des Ausschlusses der Oberfläche der „vorhersehbaren Fehlanwendungskontaktteile” vermeidet.
Vorhersehbare Fehlanwendung hat in regulatorischen Anwendungen zunehmend an Bedeutung gewonnen, und es stellt sich die Frage, wie es von den benannten Stellen durchgesetzt werden soll.
Wie könnte der Gutachter also alle möglichen vorhersehbaren Fehlanwendungsszenarien abdecken und behandeln, um Fragen von Prüfern zu vermeiden bzw. zu reduzieren?
Grundsätzlich ist „Fehlanwendung“ ein recht weit gefasster Begriff, der jede Gerätefehlanwendung einschließen kann, selbst extreme Szenarien, die nicht mehr rational abgedeckt werden können und eindeutig nicht unter das Konzept der vorhersehbaren Fehlanwendung fallen. Die Schwierigkeit liegt jedoch in solchen Grenzfällen, in denen eine Unterscheidung zwischen Fehlanwendung im Allgemeinen und vorhersehbarer Fehlanwendung nicht einfach ist und die Analyse möglicher vorhersehbarer Fehlanwendungsszenarien unvollständig ist.
Außerdem stellt sich die Frage, ob es nicht ausreicht, in der Gebrauchsanweisung klar die Zweckbestimmung des Geräts anzugeben und darauf hinzuweisen, welche vorhersehbaren Fehlanwendungsszenarien von den Benutzern des Geräts zu vermeiden sind.
Der neue Entwurf geht leider nicht zufriedenstellend auf diese Fragen ein – was sein schwächster Punkt sein könnte und in Zukunft zu einer erneuten Überarbeitung dieses Themas führen könnte – und bietet den Gutachtern auch keine klare Anleitung, wie sie bei der Analyse vorhersehbarer Fehlanwendungsszenarien vorgehen sollen.
Eine denkbare Möglichkeit, ein breites Spektrum möglicher vorhersehbarer Fehlanwendungen abzudecken, könnte darin bestehen, Informationen von Klinikern/Anwendern über vergleichbare/vorhandene Produkte auf dem Markt zu sammeln. Befindet sich ein Produkt noch in der Entwicklungsphase, könnten mögliche vorhersehbare Fehlanwendungsszenarien durch geeignete Tests ermittelt werden, z. B. durch mechanische Belastungstests, um Veränderungen am Produkt in Extremszenarien zu überwachen.
Biologische Risikobewertung als wesentlicher Bestandteil des biologischen Bewertungsplans
Die biologische Risikobewertung wird zwar auch in der aktuellen ISO 10993-1 als Konzept erwähnt, aber im Entwurf der ISO/DIS 10993-1 stärker betont. Sie sollte nun ein integraler Bestandteil des biologischen Bewertungsplans sein. Anhang C enthält eine Leitlinie für die biologische Risikobewertung. Der Hersteller sollte die biologischen Risiken, sofern vorhanden, angemessen identifizieren. Der Schwere und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens biologischer Schäden sollten qualitative oder quantitative Werte zugewiesen werden. Diese Werte, die entweder durch qualitative Beurteilung oder quantitative Berechnung ermittelt werden, werden dann kombiniert, um die biologische Risikoeinschätzung zu erhalten. Wenn die resultierenden Risiken nicht als vernachlässigbar angesehen werden können, sollten diese Risiken als Restrisiko behandelt und als Input für die Nutzen-Risiko-Bewertung berücksichtigt werden.
Die biologische Bewertung ist keine einmalige Bewertung für die Marktzulassung mehr, sondern ein Prozess, der sich auf den gesamten Lebenszyklus des Produkts bezieht.
Alle Phasen im Lebenszyklus eines Medizinprodukts, von der ersten Konzeption bis zur endgültigen Außerbetriebnahme und Entsorgung, müssen bei der biologischen Sicherheitsbewertung berücksichtigt werden.
Aufbereitungszyklen (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) für wiederverwendbare Produkte, Transport und Lagerung gemäß der festgelegten Haltbarkeitsdauer bis zur Verwendung können die Biokompatibilität beeinträchtigen. Insbesondere Polymere, aber auch Keramiken, Metalle und Legierungen können durch Verschleiß, Lagerung und Aufbereitungsverfahren einer Degradation unterliegen. Degradationen können physikalischer oder chemischer Natur sein.
Bisher wurde die Berücksichtigung der Biokompatibilität während des gesamten Lebenszyklus in der derzeit geltenden Norm nur in einem kurzen Absatz erwähnt. Dies hat sich im neuen Entwurf geändert. Leitlinien zur Materialauswahl hinsichtlich der Eignung des Materials für den gesamten Lebenszyklus von Produkten finden sich in Anhang A.2, ebenfalls mit klaren Verweisen auf Verarbeitungsmethoden während des Produktlebenszyklus.
In ISO/DIS 10993-1 wird auch ausdrücklich die aktive Datenerfassung durch den Hersteller des Produkts während des Produktlebenszyklus gefordert. Das bedeutet, dass Daten aus der Überwachung nach dem Inverkehrbringen für den Prozess der Bewertung der biologischen Sicherheit deutlich an Bedeutung gewinnen.
Achten Sie auf die veröffentlichte Norm!
Der zugrunde liegende Entwurf der Norm ISO 10993-1 befindet sich seit September 2025 im Veröffentlichungsprozess. Das bedeutet, dass die Norm spätestens bis Ende des Jahres veröffentlicht wird. Daher ist mit der Veröffentlichung der EN ISO-Version für 2026 zu rechnen. Sie benötigen Unterstützung, um auch 2026 konform zu bleiben? Kompetente Experten auf dem Gebiet der Biokompatibilität unterstützen Sie bei der Bewertung toxikologischer Parameter, die mit der neuen überarbeiteten Norm harmonisiert sind. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Bitte beachten Sie, dass alle Angaben und Auflistungen nicht den Anspruch der Vollständigkeit haben, ohne Gewähr sind und der reinen Information dienen.